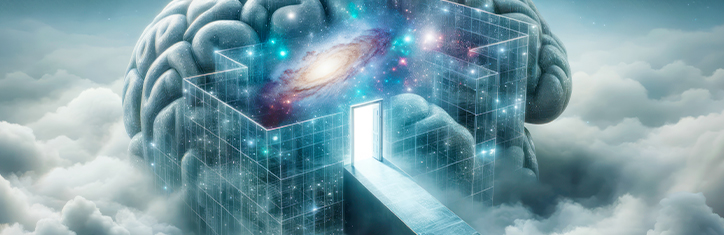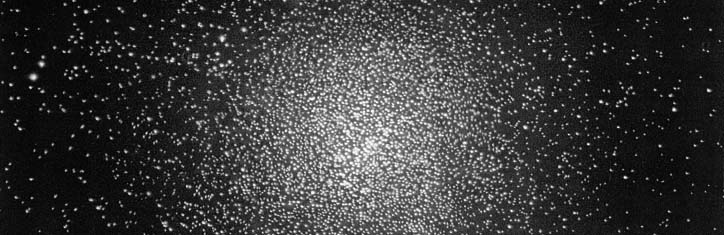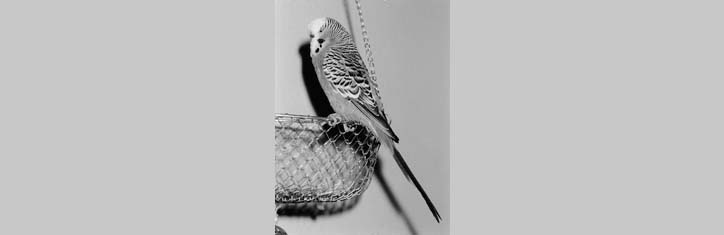Aristotelische Logik kennt nur zwei Zustände: Ja und Nein. Sie dominiert und strukturiert die Mathematik, die Wissenschaft und das Denken. Aber spätestens mit dem Aufkommen der Quantenphysik knarzt es gewaltig im Gebälk des Abendlandes. Manfred Jelinski untersucht in seinem Essay die nicht-aristotelische Logik, ihren Spuk in einer irrationalen Welt und ihren Bezug zu Remote Viewing.
Die wenigsten Leser werden mit dem Begriff Nicht-Aristotelische Logik etwas anfangen können. Mir selbst kam er zum ersten Mal in die Quere, als ich mit 14 Jahren begeistert das Angebot an Trivialromanen durchpflügte. Doch so trivial waren die oft nicht. Bedeutende Werke wurden im Heftchenformat veröffentlicht. Da gab es die Akzeptanz für das Unglaubliche.
Ich war fasziniert von Alfred E. Van Vogts Doppelroman World of Null-A / Pawns for Null-A . Darin wird gezeigt, wie man durch ein anderes Denksystem Kriege gewinnen konnte erstaunlich! Und es war klar, dass hiermit nicht fernöstliche Kampfkunst gemeint war. Eigentlich stellte van Vogt nur klar, dass man siegt, wenn man eine absolut unlogische Verfahrensweise benutzt.
Historische Ansätze davon finden sich u. a. im Korea- und Vietnamkrieg und eigentlich in jedem Krieg, in dem unterlegene Kräfte sich als Partisanen auf Sabotageakte beschränken und damit den Aggressor letztlich vertreiben. Historisch belegt.
Und so begegnete mir nicht-aristotelische Logik zu allererst als Kriegswaffe.
Zwei Pole
Gemeinhin nimmt man die Welt als zweiwertig wahr. Meine Existenz und deine Existenz. Immerhin haben wir uns nach Ren Descartes (franz. Philosoph, 1596 1650) entschieden, dass überhaupt eine Exis-tenz besteht, wenn wir denken. Das ist schon mal gut. Dann können wir auch etwas sehen und anfassen. Subjekt und Objekt. Und stellen fest: Überall gibt es zwei Parteien, zwei Pole, Ying und Yang, Bewegung und Entropie, Sein und Negation. In
solch einem Rahmen konnte man sich einrichten und tatsächlich funktioniert das ganz gut. Der Vertreter dieser Klarheit, Aristoteles, avancierte zum realistischen Lebensberater.
Aber so einfach funktioniert die Welt nicht. Alles, was gedacht wird, gehört auch zum Inventar des Universums. Und so gerät ein Subjekt durchaus in andere definierte Zustände, sodass man eine weitere Komponente einführen muss, um das Sein zu beschreiben.
Wie wäre es, sagte der griechische Denker Plato (ca. 428 348), wenn Subjekt und Objekt nur eine Projektion des Seins an der Wand ihrer Höhle wahrnehmen würden, wenn es also außerhalb der materiellen Welt noch ein Universum des Gedachten gäbe, der Interpretation, der Zufälligkeit, der Nichtvereinbarkeit? Doch was ist der Sinn dieser Logik für den Alltag?